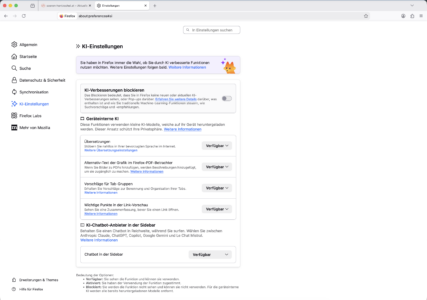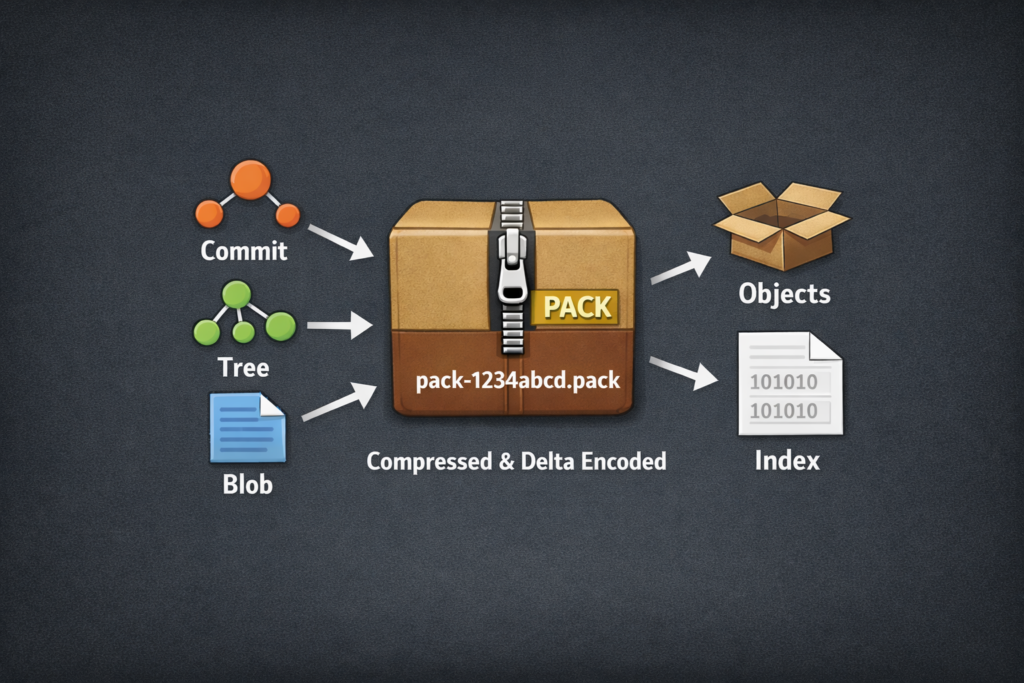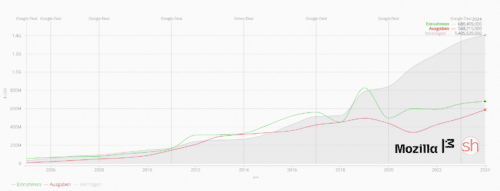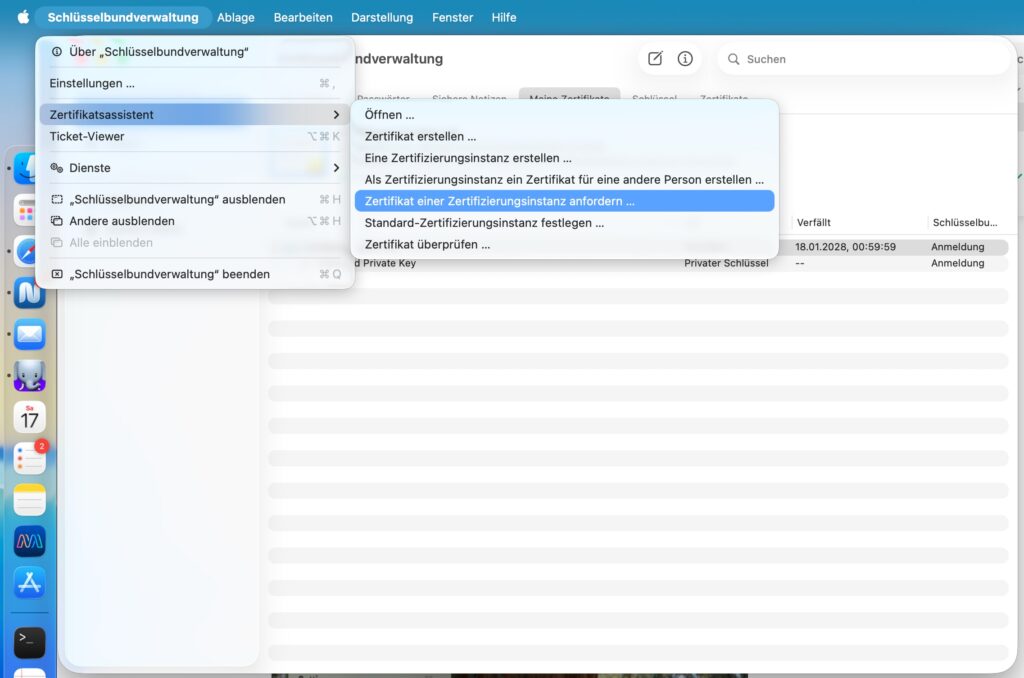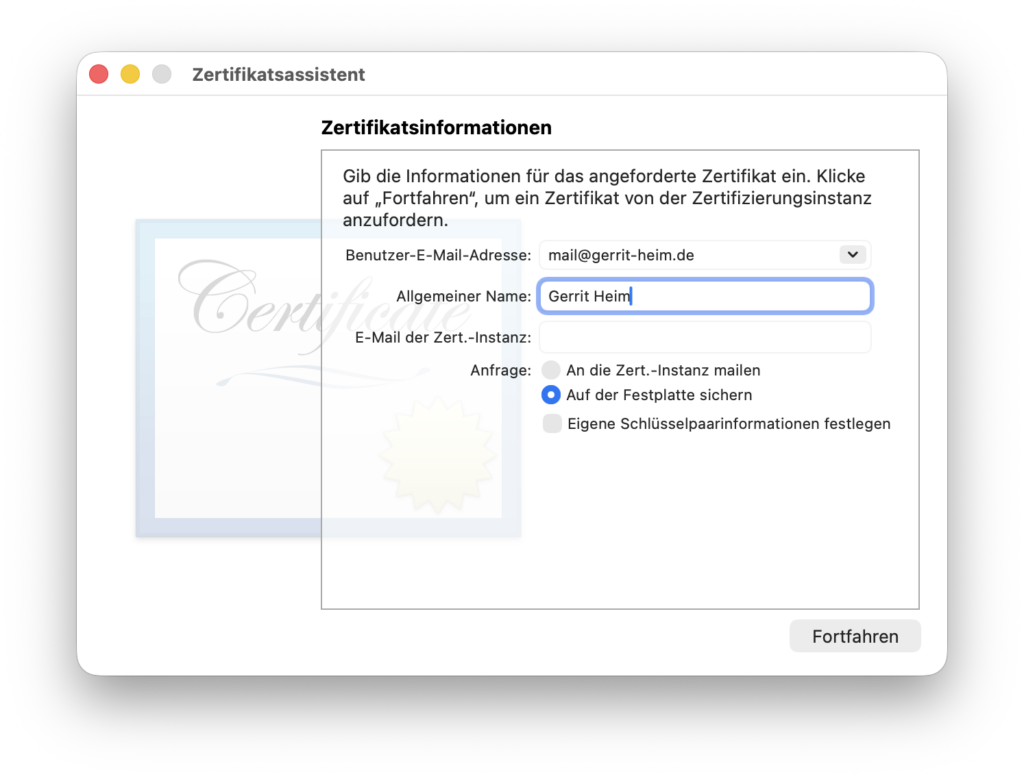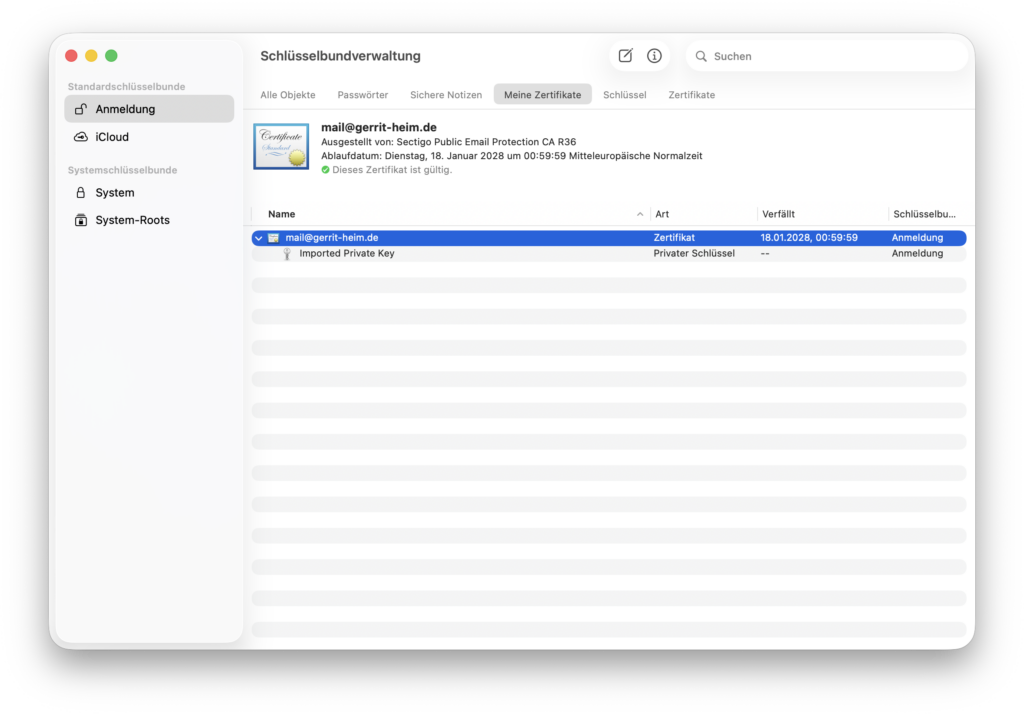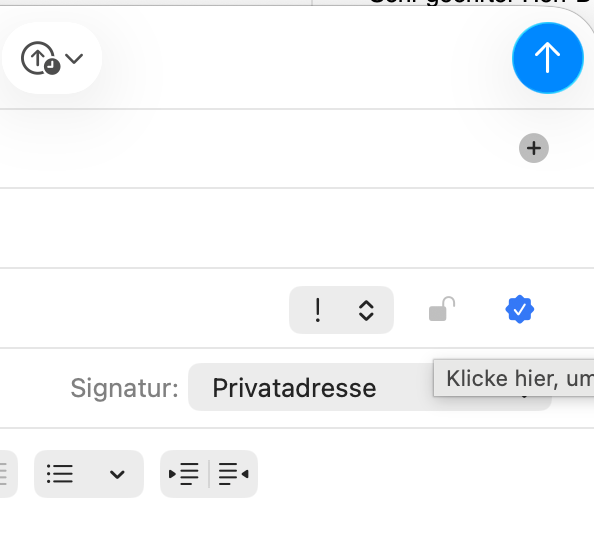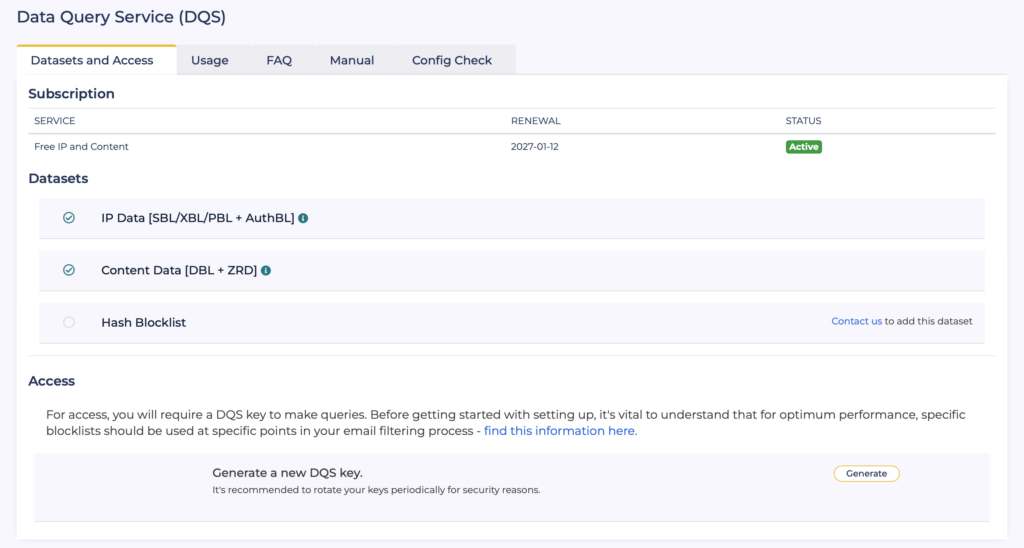Seit Jahren verwende ich die Versionsverwaltung Mercurial. Und ich bin sehr zufrieden damit. Allerdings muss oder will ich ab und zu Code auf Plattformen wie Codeberg veröffentlichen. Diese unterstützen Mercurial aber offiziell nicht. Daher nutze ich zusätzlich die Erweiterung hg-git die es ermöglicht Plattformen wie Github oder Codeberg mit Mercurial zu nutzen. Hg-git hat allerdings ein Problem.
Und zwar erfolgt die Entwicklung recht schleppend. Was aktuell ungünstig ist, da sich bei Mercurial als auch bei Dulwich (Abhängigkeit von hg-git) in letzter Zeit einige geändert hat. Also, selbst wenn man vorhandene Merge Requests manuell installiert ist die Erweiterung aktuell nicht nutzbar. Für mich aktuell kein Problem, weil ich aktuell nichts über Codeberg & Co. veröffentlichen muss.
Aber da ich die Versionsverwaltung Jujutsu sowieso mal ausprobieren wollte, hatte ich aufgrund des Problems mit hg-git mal einen Grund es zu machen.
Müsste ich nach 2 Tagen des Testens Jujutsu beschreiben, würde ich die Aussage treffen, dass Mercurial und Git miteinander ein Kind gezeugt haben, dass aber irgendwann seinen eigenen Weg gegangen ist. Und ja, mir gefällt es. So ist beispielsweise das Auflösen von Konflikten meiner Meinung nach einfacher als bei Git. Und Mercurial.
Jujutsu macht allerdings viele Dinge anders als es Nutzer gewohnt sind. Es gibt somit keine “Staging Area”. Was beispielsweise dazu führt, dass so etwas wie “git add” nicht nötig ist. Und auch das Arbeitsverzeichnis ist sozusagen ein Commit für sich. Genauer kann und will ich darauf nicht eingehen. Zum einen, weil ich mich noch zu wenig auskenne. Aber auch, weil der Artikel sonst zu umfangreich wird. Anfangs habe ich auch überlegt, was die Entwickler geritten hat solche und andere Entscheidungen zu treffen. Aber wenn man seine Vorkenntnisse mit anderen VCS ignoriert, sind diese irgendwie nachvollziehbar. Und wenn man sich darauf einlässt, sind diese Unterschiede sogar aus meiner Sicht sogar gut.
Wird nun Jujutsu noch in diesem Jahr Git ersetzen? Auch wenn immer mehr Jujutsu verwenden (z. B. Google), lautet die Antwort “nein”. Zum einen, weil viele Nutzer nach dem Motto “never change a running system” vorgehen. Aber auch weil, Jujutsu noch nicht den gesamten Funktionsumfang wie Git bietet. Aber Jujutsu ist bereits eine ernstzunehmende Alternative zu Git für viele Nutzer. Auch für die, die lieber Mercurial nutzen.
Für die Leute, die sich für Jujutsu interessieren, hier ein paar Links die mehr Informationen liefern.
- https://www.jj-vcs.dev/latest/
- https://www.jj-vcs.dev/latest/community_tools/
- https://jj-for-everyone.github.io
- https://steveklabnik.github.io/jujutsu-tutorial/
- https://v5.chriskrycho.com/journal/jujutsu-megamerges-and-jj-absorb/
Wer lieber bei seiner bisherigen Versionsverwaltung bleiben will, sollte bei dieser bleiben.