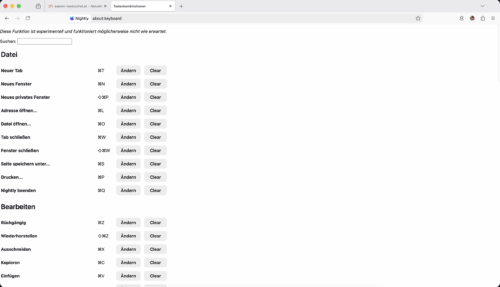Weihnachten steht vor der Tür. Wer noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk ist, findet möglicherweise auch im Produkt-Portfolio oder im Merchandise-Shop von Mozilla die eine oder andere Idee. Dieser Artikel fasst ein paar Geschenkideen zusammen.
 Mozilla VPN
Mozilla VPN
 Produkt-Beschreibung
Produkt-Beschreibung
Mit dem Mozilla VPN bietet Mozilla in Zusammenarbeit mit Mullvad sein eigenes Virtual Private Network an und verspricht neben einer sehr einfachen Bedienung eine durch das moderne und schlanke WireGuard-Protokoll schnelle Performance, Sicherheit sowie Privatsphäre: Weder werden Nutzungsdaten geloggt noch mit einer externen Analysefirma zusammengearbeitet, um Nutzungsprofile zu erstellen.
Ein VPN kann nicht nur die Privatsphäre durch Verschleierung des realen Aufenthaltsortes verbessern, es kann auch bei der Umgehung von Geo-Restriktionen beispielsweise bei Live-Übertragungen oder Video-Streams helfen. In Kombination mit der kostenlosen Browser-Erweiterung besteht für Firefox-Nutzer außerdem die einzigartige Möglichkeit, in unterschiedlichen Tabs über jeweils unterschiedliche Länder verbunden zu sein.
 Preis
Preis
Das Mozilla VPN kostet 9,99 € pro Monat bei nur einem Monat Bindung respektive 59,88 € pro Jahr, was einer Ersparnis von 50 Prozent entspricht.
 Zur Produktseite vom Mozilla VPN
Zur Produktseite vom Mozilla VPN
 Firefox Relay Premium
Firefox Relay Premium
 Produkt-Beschreibung
Produkt-Beschreibung
E-Mail-Adressen sind gleichzusetzen mit einer persönlichen Adresse. Sie sind einmalig und viele Nutzer besitzen nur eine einzige E-Mail-Adresse, die sie teilweise auf dutzenden, wenn nicht gar auf hunderten Websites verwenden. Findet auf einer Website, auf der man mit seiner E-Mail-Adresse registriert ist, ein Datendiebstahl statt, wird damit in vielen Fällen auch die persönliche E-Mail-Adresse offengelegt. Und haben Spammer erstmal eine E-Mail-Adresse in ihrem System, darf man sich auf viele unerwünschte E-Mails ohne realistische Hoffnung einstellen, dass der Spam abnehmen wird.
Mit Firefox Relay können sogenannte Masken als Alias-Adressen angelegt werden, die der Nutzer für Newsletter-Anmeldungen und Website-Registrierungen angeben kann. Firefox Relay leitet diese E-Mails dann an die persönliche E-Mail-Adresse weiter. Außerdem kann Firefox Relay bekannte Tracking-Scripts aus E-Mails entfernen.
Firefox Relay ist kostenlos. Es gibt aber auch eine kostenpflichtige Premium-Version, welche unendlich viele Masken anstelle von nur fünf sowie eine eigene E-Mail-Domain erlaubt. Außerdem können in Firefox Relay Premium auf weitergeleitete E-Mails geantwortet und Werbe-Mails automatisch blockiert werden.
 Preis
Preis
Firefox Relay Premium kostet 1,99 € pro Monat bei nur einem Monat Bindung respektive 11,88 € pro Jahr, was einer Ersparnis von 50 Prozent entspricht.
Nutzer in den USA und Kanada können optional auch noch eine Telefonnummer-Maskierung als optionales Zusatzpaket dazu buchen. Wer sich dafür entscheidet, erhält ein Kontingent von 50 Sprachminuten für eingehende Anrufe sowie 75 Text-Nachrichten pro Monat. Die Kosten dafür liegen bei 4,99 USD pro Monat respektive 47,88 USD pro Jahr, was einer Ersparnis von 20 Prozent entspricht.
Ebenfalls in den USA und Kanada möglich ist eine Bündelung mit dem Mozilla VPN. In dem Fall bezahlt man nur 83,88 USD statt 107,76 USD und erhält dafür beide Produkte für ein komplettes Jahr.
 Zur Produktseite von Firefox Relay Premium
Zur Produktseite von Firefox Relay Premium
 Solo Pro
Solo Pro
 Produkt-Beschreibung
Produkt-Beschreibung
Solo ist ein Website-Builder von Mozilla, der auf Künstliche Intelligenz (KI) und einen einfachen Erstellungsprozess setzt. Neben der kostenlosen Version gibt es auch eine Pro-Version mit zusätzlichen Vorteilen.
Mit Solo Pro kann man bis zu fünf statt bis zu drei Websites veröffentlichen, bis zu 25 statt nur drei Entwürfe speichern und bis zu drei statt nur einer Domain verbinden. Eine benutzedefinierte Domain bis zu einem Wert von 12 USD pro Jahr ist inklusive. Wem 25 Bilder-Uploads pro Website nicht ausreichen, kann bis zu 100 Bilder hochladen und es können bis zu fünf Personen an einer Website arbeiten. Pro-Nutzer können Websites duplizieren und auch im <head>-Bereich der Website benutzerdefinierten Code hinzufügen. Außerdem berechtigt die Nutzung der Pro-Version zum Entfernen des Solo-Logos in der rechten unteren Ecke der erstellten Websites.
 Preis
Preis
Solo Pro kostet 25 USD pro Monat bei nur einem Monat Bindung respektive 240 USD pro Jahr, was einer Ersparnis von 20 Prozent entspricht.
 Zur Produktseite von Mozilla Solo Pro
Zur Produktseite von Mozilla Solo Pro
 MDN Plus
MDN Plus
 Produkt-Beschreibung
Produkt-Beschreibung
Die kostenfreie Entwickler-Dokumentation MDN Web Docs, ehemals Mozilla Developer Network, dürfte vermutlich jedem bekannt sein, der bereits mit dem Thema Webentwicklung in Berührung kam. Immerhin ist dies wohl für viele die Anlaufstelle Nummer Eins, wenn es um Themen wie HTML, CSS und JavaScript geht. MDN Plus bietet zusätzliche Funktionen für Nutzer.
Mit den „Updates“ besitzen die MDN Web Docs eine tabellarische Auflistung von Dokumentations-Änderungen in Zusammenhang mit Browser-Updates. Nutzer von MDN Plus erhalten zusätzliche Funktionen zum Filtern und Sortieren sowie zum direkten Speichern in einer eigenen Sammlung.
Seiten können mit MDN Plus zu sogenannten Sammlungen hinzugefügt und damit an einem zentralen Ort gesammelt und außerdem mit Notizen versehen werden.
MDN Playgrounds erlauben das Experimentieren mit Code. Nutzer von MDN Plus können ihre Playgrounds mit anderen Nutzern teilen. Außerdem haben Nutzer von MDN Plus Beta-Zugriff auf einen KI-Assistenten, der Fragen in Echtzeit auf Basis der MDN-Inhalte beantwortet.
 Preis
Preis
Mozilla bietet MDN Plus in mehreren Preisstufen an. Eine kostenlose Registrierung bietet Zugriff auf alle oben genannten Vorteile. Dabei sind die Sammlungen auf maximal drei Stück und der KI-Assistent auf bis zu fünf Fragen pro Tag limitiert.
MDN Plus 5 bietet alle Vorteile in unbegrenzter Form, zusätzlich die Möglichkeit zur Offline-Speicherung von Artikeln sowie komplette Werbefreiheit und kostet 5,00 € pro Monat bei nur einem Monat Bindung respektive 50,00 € pro Jahr, was einer Ersparnis von knapp 17 Prozent entspricht.
MDN Supporter 10 bietet die gleichen Leistungen wie MDN Plus 5 und gewährt zusätzlich frühen Zugriff auf neue Features. Vor allem aber richtet sich diese Option an all jene, welche den Betrieb der kostenlosen MDN Web Docs noch mehr unterstützen wollen. Denn diese Option kostet mit 10,00 € pro Monat bei nur einem Monat Bindung das Doppelte, respektive 100,00 € pro Jahr, was erneut einer Ersparnis von knapp 17 Prozent entspricht.
 Zur Produktseite von MDN Plus
Zur Produktseite von MDN Plus
 Merchandise-Artikel von Mozilla
Merchandise-Artikel von Mozilla
T-Shirts, Pullover, Mützen, Taschen, Tassen und mehr gibt es im offiziellen Merchanise-Shop von Mozilla. Dabei stehen Designs von Mozilla, Firefox, Thunderbird, Pocket, Mozilla Hubs sowie dem Mozilla Festival zur Verfügung. Hier gibt es auch schon Artikel mit Kit, dem neuen Maskottchen von Mozilla.
 Zum Merchandise-Shop von Mozilla
Zum Merchandise-Shop von Mozilla
 Spenden an die Mozilla Foundation
Spenden an die Mozilla Foundation
Während die Entwicklung von Firefox sowie der kommerziellen Produkte in die Zuständigkeit der Mozilla Corporation fällt, gibt es auch noch die gemeinnützige Stiftung, welche auf den Namen Mozilla Foundation hört. Deren Arbeit, welche weit über die Produktentwicklung hinausgeht und unter anderem Themen wie Internet-Politik betrifft, wird durch Spenden finanziert.
 Für die Mozilla Foundation spenden
Für die Mozilla Foundation spenden
 Spenden für Thunderbird
Spenden für Thunderbird
Auch der kostenfreie E-Mail-Client Thunderbird nimmt eine besondere Position ein, da dieser weder ein Produkt der Mozilla Corporation noch der Mozilla Foundation ist, sondern von der MZLA Technologies Corporation, einer weiteren Mozilla-Tochter, entwickelt und komplett durch Spenden finanziert wird.
 Für Thunderbird spenden
Für Thunderbird spenden
 Bonus: Spenden für den ehrenamtlichen Firefox-Support
Bonus: Spenden für den ehrenamtlichen Firefox-Support
Diesen Punkt möchte ich als Bonuspunkt anführen, da dieser nicht Mozilla selbst betrifft. Die Unterstützung bei Problemen mit Firefox und anderen kostenlosen Mozilla-Produkten geschieht auf ehrenamtlicher Basis. Ich bin nicht nur der Betreiber von soeren-hentzschel.at, sondern gleichzeitig auch von camp-firefox.de, der größten Support-Plattform zu Firefox im deutschsprachigen Raum. Der Betrieb einer solchen Plattform verursacht Kosten und zwar jährlich in hoher dreistelliger Höhe, an erster Stelle für den Server sowie für benötigte Software. Arbeitskosten sind dabei noch gar nicht mit einberechnet. Wer den langfristigen Betrieb dieser wichtigen Support-Plattform für Firefox unterstützen möchte, kann auch für camp-firefox.de spenden.
 Für camp-firefox.de spenden
Für camp-firefox.de spenden
Der Beitrag 🎄🎁 Weihnachten steht vor der Tür – Produkte von Mozilla als Geschenkidee erschien zuerst auf soeren-hentzschel.at.



 Mozilla VPN
Mozilla VPN Produkt-Beschreibung
Produkt-Beschreibung Preis
Preis